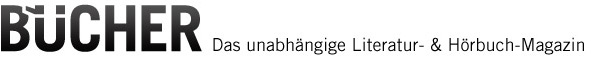Poetische Spurensuche
Was macht eigentlich die Lyrik? Man sieht sie nur noch selten in der Öffentlichkeit, und wenn, dann redet sie wirr. BÜCHER geht mal bei ihr vorbei und guckt, wie es ihr geht.
Eigentlich hatten wir immer ein gutes Verhältnis. Ich werde einfach bei ihr klingeln. Vielleicht lädt sie mich auf Tee und Kekse ein. „Weißt du noch“, werde ich sagen, „wie du ausgesprochen hast, was wir denken, bevor wir selbst davon wussten? ,Bedecke deinen Himmel, Zeus, / Mit Wolkendunst!‘ Du kanntest uns in-, wir dich auswendig.“ Sie wird stumm eine Augenbraue hochziehen und ich werde zugeben müssen, dass das ein blödes Wortspiel ist. „Und weißt du noch, wie du uns abgelenkt hast, als wir über uns selbst erschrocken waren?“, werde ich sagen. „,Unter eines Baumes Rinde / wohnt die Made mit dem Kinde‘?“ Sie in die Seite zu stoßen wäre wohl zu vertraulich. Hoffentlich hat sie überhaupt Tee und Kekse da.
Was wohl aus ihr geworden ist? Ich frage Andreas Heidtmann. 2005 gründete er die Online-Plattform poetenladen, ein niedrigschwelliges Angebot für junge Schreibende, 2007 den gleichnamigen Verlag und die Literaturzeitschrift poet. Bei ihm veröffentlichten Judith Zander und Nora Bossong schon, als sie noch Unbekannte waren. In der Lyrik der Gegenwart erkennt Heidtmann verschiedene Strömungen: eine avancierte Poesie, „eine sprachexperimentelle Richtung“, repräsentiert durch Dichter wie Norbert Lange und Mara Genschel, deren Gedichte stark von der Arbeit mit der Sprache leben. „In diesem Bereich würde ich auch die Sprach-Archäologen ansiedeln, die bereits vorhandenes Material neu arrangieren, etwa Michael Fiedler.“ Lyriker wie Jan Wagner oder Ann Cotten, „die bewusst Formen aufgreifen und damit auf neue Weise spielen“, ordnet er einer formbedachten Poesie zu. Die meisten jungen Lyriker sieht er als Vertreter einer reflektierten Poesie: „Die arbeiten mit einem avancierten Anspruch, verweigern sich aber nicht dem Leser. Es gelingt ihnen auf hohem sprachlichem Niveau eine Poesie zu entwickeln, die gleichermaßen neu wie reflektiert ist.“ Hier nennt er etwa Ulrike Almut Sandig und Tom Schulz. „Ganz wichtig sind auch jene, die abseits der Metropolen stehen, die aus dem Ausland oder aus gewissen Weltanschauungen kommen und der Dichtung immer wieder entscheidende Impulse vermitteln, wie Manfred Peter Hein oder Christian Lehnert.“ Heidtmann spricht von einer Poesie der Peripherie. Aber auch die traditionelle Poesie gebe es nach wie vor: „Einige Dichter arbeiten sehr klassisch, etwa Alexander Nitzberg, Lutz Seiler, Daniela Danz.“
Die Enzensbergersche Konstante
Ob die Lyrik eine Randerscheinung ist, hängt von der Position des Betrachters ab. Aus der Vogelperspektive erscheint ihr Anteil an der deutschen Gegenwartsliteratur gering. Unter den 15.141 belletristischen Werken, die 2011 in Deutschland in Erstauflage erschienen, sind nur 202 lyrische. Und ein Viertel dieser Neuerscheinungen enthalten neu zusammengestellte oder kommentierte Gedichte bekannter toter Autoren: Schiller, Rilke, Ringelnatz. In den großen Publikumsverlagen profitiert zeitgenössische Lyrik vom Konzept der Mischkalkulation, denn selbst Werke von Durs Grünbein oder Herta Müller erreichen selten Auflagen von über 3000 Exemplaren. „Ein Lyriker kann sich glücklich schätzen, wenn er 1500 Exemplare eines neuen Bandes verkauft“, sagt der Literaturkritiker Michael Braun, „das wird aber in der Regel nicht erreicht.“ Die „Enzensberger‘sche Konstante“ gelte noch immer. In seinem Essay „Meldungen aus dem lyrischen Betrieb“ (1989) bezifferte Enzensberger die Anzahl der Menschen, „die einen neuen, einigermaßen anspruchsvollen Gedichtband in die Hand nehmen“ auf ± 1354.
„Die innovativsten Gedichtbände dieser Jahre erscheinen in kleinen, unabhängigen Verlagen“, sagt Braun. Zu nennen sind etwa kookbooks aus Berlin und Heidtmanns poetenladen, Institutionen, die von wenigen, hart arbeitenden Literaten aufrechterhalten werden. Geld verdienen kann man mit Lyrik nicht. „Wir arbeiten mit Startauflagen von 150 bis 200 Exemplaren“, erklärt Christian Lux, Inhaber des Wiesbadener Verlags luxbooks. „Manchmal greifen wir höher. Aber mehr als 300 machen wir nie.“ Der Schweizer Verlag Urs Engeler Editor hat sich 2010 unter dem Namen roughbooks vom konventionellen Buchhandel abgekoppelt. Die Bände werden im Digitaldruck und in Kleinstauflagen produziert, bekommen keine ISBN und stehen nicht im Verzeichnis lieferbarer Bücher. Vertrieben werden sie übers Internet und einige wenige Buchhandlungen. „Die roughbooks sind und bleiben Bücher“, so Engeler, „nur ist ihre Herstellung den Tendenzen eines der Poesie feindlich gesinnten Marktes angepasst.“ Der Kölner Verlag parasitenpresse geht noch einen Schritt weiter: Die 16-seitigen Heftchen werden in Handarbeit hergestellt, mit Tacker und Tintenstrahldrucker. Ihre Cover sind aus Packpapier, alten Briefumschlägen oder gebrauchten Aktentrennern.
Hochkultur und Wahnsinn
Die Lyrik hat also kein Geld, und das liegt auch daran, dass sie kein großes Publikum findet. Sie ist anstrengend. Oft spricht sie in Rätseln. Entweder ist sie wahnsinnig geworden, vermuten wir, oder sie macht sich über uns lustig und wir können uns nicht wehren, haben wir doch gelernt, zu ihr aufzuschauen. Schließlich handelt es sich um Hochkultur.
Wer die Lyrik der Gegenwart kennenlernen möchte, muss diese Rezeptionshaltung aufgeben. „Man liest ein Gedicht am besten ohne Ehrfurcht“, meint der Berliner Dichter Björn Kuhligk, Mitherausgeber der wegweisenden Anthologie „Lyrik von Jetzt“. Monika Rinck, Preisträgerin zuletzt des Berliner Kunstpreises Literatur, sagt, es gebe keine „richtigen“ oder „falschen“ Deutungen. „Es ist eher so: Eine Person nimmt Kontakt auf zu einem Gedicht und hat einen neuen Gedanken. Wie: ,Man könnte Teiche nehmen, sie hochkant stellen und wegtragen!‘“ Als ich sie frage, ob eines ihrer Werke schon einmal grob fehlinterpretiert worden sei, erzählt sie von ihrem Gedicht „Trainingsziele“, in dem ein Mädchen sich seiner sexuellen Abenteuer rühmt, zuletzt einer Nacht mit dem „king of hallenfrisbee! […] im geräteraum der mehrzweckhalle bourg en bresse“. Was Rinck als eine Reihe von Triumphen angelegt hatte, deutete eine Redakteurin als Niedergang. Tom Schulz, dessen jüngstes Buch „Innere Musik“ gerade im Berlin Verlag erschienen ist, hat ähnliche Erfahrungen gemacht. „Man hat mir schon einmal vorgeworfen, ich würde alten Menschen feindlich und bösartig gegenüberstehen, weil ich das Wort ,Kaltmamsell‘ verwendet habe. Aber ich finde es gut, wenn sich nicht alle über meine Texte einig sind. Das ist demokratisch.“ Michael Braun rät dazu, ein Gedicht als Gesprächsangebot zu verstehen.
Formlosigkeit und Willkür
Wenig ist so wundersam und unbefriedigend wie jemanden die Entstehung eines Gedichts erklären zu lassen. „Ich schreibe von vorne nach hinten, vom Anfang zum Ende“, sagt Tom Schulz. „Wisława Szymborska hat hin und wieder rückwärts gearbeitet, aber ist auch Nobelpreisträgerin geworden.“ Von Monika Rinck will ich wissen, welcher Regung ihr Gedicht „Honighohn“ entstammt, das zweite in ihrem jüngsten Buch. „Das ging von einer Vorstellung von Süße aus, Überorchestrierung, Verwirrung, zu viele Einzelheiten, als würde es Zuckerwerk regnen, Klebrigkeit, unglaublich dichte Luft, als befände man sich … nicht in einem Bienenschwarm, sondern in einem Schwarm kandierter Früchte, und das alles sei auf molekularer Ebene, ein einziger Gedanke.“ „Und wie wird das zu Worten?“ „Die Worte muss man finden.“ „Und ist das einfach?“ Rinck lacht. „Natürlich nicht!“ Björn Kuhligk notiert Dinge, die ihm im Vorübergehen auffallen, und sammelt sein Ausgangsmaterial in einer Datei. „Und irgendwann schaue ich mir das an und bemerke, dass Teile zusammenpassen.“ Alle drei Autoren berichten von Phasen sorgfältiger Recherche, insbesondere bei Auftragsarbeiten. Überdies kann es Jahre dauern, bis ein Gedicht seine endgültige Form erhalten hat.
Und wie du wieder aussiehst! Eines der am weitesten verbreitetsten Vorurteile der zeitgenössischen Lyrik gegenüber ist die Annahme, sie sei formlos. Nur wenige Autoren arbeiten noch mit regelmäßigen Endreimen. „Ich schreibe nicht gereimt“, erklärt Björn Kuhligk. „Die Welt, die mir draußen begegnet, reimt sich auch nicht, sondern ist eine Ansammlung von Zitaten und Bruchstücken.“ Zeilenumbrüche in Enjambements scheinen auf den ersten Blick oft willkürlich. Dabei müsste gerade die Freiheit, sich jedweder Konvention zu bedienen, sie zu verwerfen oder zu brechen, der Form größere Bedeutung verleihen. „Form ist dem Gedicht inhärent, und welche Form einem Gedicht angemessen ist, muss für jedes Gedicht neu entschieden werden“, sagt Michael Braun. „Wenn ein Gedicht einem formlos erscheint, dann muss man es eben noch einmal anschauen, vielleicht gibt es eben doch Assonanzen, versteckte Binnenreime, vielleicht folgt jeder Vers streng einer bestimmten Silbenzahl. Der Vorwurf der Formlosigkeit beruht meist auf ungenauer Lektüre.“
Die Sprachordnung erschüttern
„Was macht ein gutes Gedicht aus?“, frage ich Braun. Er ist der Herausgeber des Deutschlandfunk Lyrikkalenders und mehrerer Anthologien. Wer mit ihm telefoniert, kann die übervollen Bücherregale und die Papiere auf dem Schreibtisch hören. „Ein Kriterium“, erklärt er, „entnehme ich einem Aphorismus des Dichters Paul Wühr, der hat mal geschrieben: ,Ich will, dass alles, was gesagt wird, ins Wackeln kommt, immer wieder neu.‘ Ein Gedicht soll die Sprachordnung, die uns im Alltag zur Verfügung steht, erschüttern, sabotieren, verrücken. Wenn ein Gedicht nur wiederholt, was ein Tagesschaukommentar sagt und dafür einige Bilder findet, ist es nicht spannend.“ Das dürfe ich durchaus als Kommentar zu Günter Grass‘ jüngsten Israel- und Griechenland-Gedichten verstehen. „Ein gutes Gedicht spricht auf irgendeine Weise von den Elementen der Existenz, von dem, was uns im Innersten angeht und berührt.“ Er möchte das nicht als Absage an politische Lyrik verstanden wissen – nur an solche, die als wohlfeile Meinungsäußerung daherkomme. „Wenn aber das Wahrnehmungssystem, mit dem wir politische Geschehnisse, die Natur, die uns umgebende Großstadtgesellschaft betrachten, durch ein Gedicht bereichert wird, wenn wir ins Staunen geraten und unsere Beobachtungen schärfer werden, dann ist das ein gutes Gedicht.“
„Und ein schlechtes, ein überflüssiges Gedicht?“ Braun überlegt kurz. „Ein schlechtes Gedicht reproduziert Abziehbilder von Meinungen, Parolen, Sentenzen, die man beim täglichen Gang durch die öffentliche Rede in den Medien finden kann. Langweilig ist es auch, wenn ein Autor romantische Töne, die er vielleicht bei Brentano oder Eichendorff gefunden hat, wiederholt. Wenn Naturmaterialien wie Wolken und Bäume zu schlechten Kopien dessen montiert werden, was die Lyrik der Romantik längst bereitgestellt hat.“ „Nebel? Und Katzen?“ „Katzen vielleicht. Nebel ganz sicher.“
– Elisabeth Dietz
Elisabeth Dietz‘ Artikel erschien in BÜCHER – Das unabhängige Literatur- & Hörbuchmagazin und wurde auch auf deren Website publiziert.